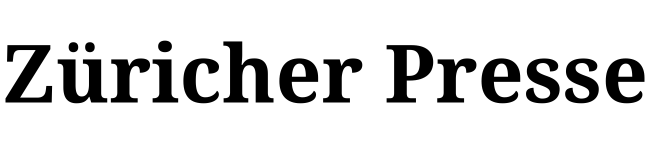Pflanzliche Erzeugung stark unter Druck
Die Lebensmittelproduktion in der Schweiz deckt immer weniger den Eigenbedarf. Zwischen 2011 und 2022 sank der Netto-Selbstversorgungsgrad von 57 auf 46 Prozent. Besonders stark fiel der Rückgang bei pflanzlichen Produkten aus – von 48 auf 37 Prozent.
Landwirtschaftsverbände wie der Schweizer Bauernverband, Bio Suisse und IP Suisse schlagen Alarm. Sie beklagen schrumpfende Anbauflächen und niedrigere Erträge. Die Verbände fordern mehr Schutz für Schweizer Kulturen und stärkere Handelsgrenzen. Auch bei tierischen Produkten sinkt die Eigenversorgung, wenn auch langsamer.
Politik streitet über Reaktion
Ob die Schweiz gegensteuern muss, sorgt für Diskussionen. Die SVP forderte nach Beginn des Ukrainekriegs 2022 einen neuen «Plan Wahlen». Dieser sollte die Ernährungssicherheit durch mehr Produktion garantieren. Umweltschonende, aber weniger ertragreiche Projekte sollten dafür gestoppt werden. Ziel sei ein deutlich höherer Selbstversorgungsgrad.
Dieser Wert zeigt das Verhältnis zwischen Produktion und Verbrauch. Beim Netto-Wert werden Importfuttermittel abgezogen. Ein Selbstversorgungsgrad von 50 Prozent bedeutet, dass nur die Hälfte der konsumierten Lebensmittel im Land produziert wird.
Martin Rufer, Direktor des Bauernverbands, warnt vor Folgen des Rückgangs: «Wir verlieren jedes Jahr ein Prozentpunkt. Unser Ziel bleibt 50 Prozent Eigenproduktion.» Er verweist auf krisenanfällige Lieferketten als Risiko.
Unterschiedliche Strategien für mehr Sicherheit
Auch aus der Umweltbewegung kommen Forderungen nach mehr Selbstversorgung. Die Initiative «Sauberes Wasser für alle» will den Wert auf 70 Prozent erhöhen. Im Gegensatz zur SVP setzt sie auf pflanzliche statt tierische Produkte – nicht auf Intensivierung.
Michele Salvi vom liberalen Thinktank Avenir Suisse warnt jedoch vor falschen Schlüssen. Er sagt, der Grad der Eigenproduktion sei weniger wichtig als die tatsächliche Versorgungssicherheit. Dazu brauche es gute Vorräte, funktionierende Logistik und offenen Zugang zu Märkten.
Auch bei sinkendem Selbstversorgungsgrad konnte die Schweiz laut Salvi ihre Bevölkerung stets gut versorgen – sogar während der Corona-Pandemie.
Importabhängigkeit bleibt bestehen
Ein hoher Selbstversorgungsgrad bedeute nicht Unabhängigkeit, sagt Salvi. Die Schweizer Landwirtschaft ist auf viele Importe angewiesen – etwa Diesel, Ersatzteile, Maschinen und Saisonkräfte.
Nur ein durchdachter Krisenplan, Pflichtlager und eine starke Einbindung in den Weltmarkt können laut Salvi Versorgungssicherheit wirklich gewährleisten. Ein hoher Produktionsanteil im Inland allein reiche dafür nicht.