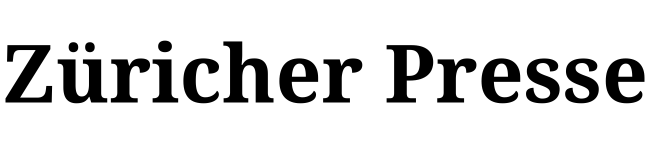Behörden in der Schweiz dürfen Doppelbürgern die Staatsangehörigkeit entziehen, wenn diese dem Land ernsthaft schaden. Dies betrifft etwa Personen, die schwere Straftaten wie Terroranschläge begehen oder fremde Staaten schwer beleidigen. Ein solcher Entzug darf nur nach einer rechtskräftigen Verurteilung erfolgen. Personen mit ausschließlich schweizerischer Staatsbürgerschaft dürfen nicht ausgebürgert werden, da dies eine Staatenlosigkeit verursachen würde – völkerrechtlich unzulässig.
Historisch gesehen entzog die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs über 80 Menschen den Pass, weil sie sich etwa mit dem Nationalsozialismus identifizierten. In jüngerer Zeit erfolgten sechs Ausbürgerungen im Kontext islamistischer Radikalisierung. Laut Forscherin Mira Schwarz schaffen diese Fälle neue Standards – mit möglichem Einfluss auf künftige politische Entscheidungen.
Internationale Vergleiche und rechtliche Entwicklungen
Andere Länder wie Deutschland oder Kanada debattieren ebenfalls über die Ausbürgerung extremistischer Personen, insbesondere sogenannter Dschihad-Reisender. Deutschland änderte 2019 seine Gesetzgebung, um Doppelbürgern nach solchen Reisen die Staatsangehörigkeit entziehen zu können. Bislang blieb diese Regel jedoch folgenlos, da Betroffene bereits vor der Gesetzesänderung ausreisten.
Der politische Zweck: Rückkehr verhindern und Gefahren eindämmen. Dennoch bleibt diese Maßnahme rechtlich und ethisch umstritten – insbesondere weil sie ausschließlich Doppelbürger trifft und damit eine Ungleichbehandlung erzeugt.
Prävention durch Integration statt Ausgrenzung
Laut Studien wirkt Ausbürgerung nicht als wirksames Mittel gegen Extremismus. Im Gegenteil: Sie könne die Ausgrenzung verstärken und damit Radikalisierung fördern. Diskriminierungserfahrungen treiben Betroffene eher weiter in extremistische Kreise.
Effektiver seien Programme, die Betroffenen helfen, sich von extremistischen Ideologien zu lösen. Dazu zählen Maßnahmen zur sozialen Wiedereingliederung, neue soziale Bindungen, Freizeitangebote oder Arbeitsintegration. Diese Inhalte sollen entstandene Lücken durch den Ausstieg aus radikalen Gruppen sinnvoll füllen.
Deutschland gilt als Vorreiter auf diesem Gebiet: Dort existieren spezialisierte Programme für verschiedene Formen von Extremismus – rechts, links oder religiös motiviert. Die Schweiz könnte laut Schwarz von dieser Erfahrung profitieren und eigene präventive Strukturen verbessern.