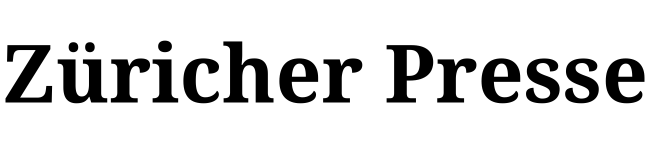Ein Traditionsschuh ohne Herkunftsangabe entfacht Kritik
Im Juni sorgte das italienische Modehaus Prada mit einem neuen Sandalenmodell für Aufruhr. Das Design erinnerte stark an die Kolhapuri-Chappal – eine handgefertigte Ledersandale aus der indischen Stadt Kolhapur. Diese Sandalen werden seit Jahrhunderten in Maharashtra produziert und sind ein wichtiger Teil regionaler Handwerkskunst. Doch Prada erwähnte weder den Namen noch den Ursprung des Designs.
Die fehlende Anerkennung löste eine Welle der Empörung aus. Nach zunehmendem öffentlichen Druck veröffentlichte das Unternehmen eine Stellungnahme. Darin erklärte es, die Herkunft der Sandale nun anzuerkennen und das Gespräch mit lokalen Handwerkern zu suchen.
Kurz darauf reiste ein Team des Unternehmens nach Kolhapur, um sich mit Kunsthandwerkern und Händlern auszutauschen. Dabei stand der Herstellungsprozess ebenso im Fokus wie der kulturelle Wert der Kolhapuri-Chappal. Ein erfolgreiches Treffen mit einer führenden Handelsorganisation wurde ebenfalls abgehalten. In Zukunft könnte es zu Kooperationen mit lokalen Produzenten kommen – konkrete Pläne gibt es bisher jedoch nicht.
Wiederkehrendes Muster in der Luxusmode
Prada steht mit diesem Fall nicht allein. Immer wieder verwenden große Modehäuser Motive aus Indien und Südostasien – oft ohne die kulturelle Herkunft zu benennen. Zu Beginn dieses Jahres wurden Designs von H&M und Reformation kritisiert, weil sie stark an traditionelle südasiatische Kleidung erinnerten. H&M wies die Vorwürfe zurück, Reformation erklärte, ein Modell aus der Zusammenarbeit mit einer Influencerin habe als Vorlage gedient.
Auch Dior geriet kürzlich unter Beschuss. Die Luxusmarke präsentierte in Paris einen Mantel mit metallischer Stickerei, die viele als „Mukaish“ erkannten – eine uralte Technik aus Nordindien. Doch in der Kollektion fehlte jede Erwähnung indischer Handwerkskunst.
Einige Modeexperten betonen, dass Designer oft kulturelle Elemente als Inspiration nutzen – ohne böse Absicht. Doch in einer schnelllebigen Branche bleibt wenig Zeit für reflektierte Entscheidungen. Trotzdem fordern Kritiker, dass besonders mächtige Marken ihre Verantwortung erkennen müssen.
Kulturelle Anerkennung ist kein Trend, sondern Pflicht
Die Verwendung traditioneller Designs ohne angemessene Würdigung stößt bei vielen Fachleuten auf Unverständnis. Respekt und Sichtbarkeit für die Herkunftskultur seien essenziell, so die Meinung vieler. Besonders dann, wenn diese Elemente zu Luxusprodukten weiterentwickelt und teuer verkauft werden. Die Designexpertin Shefalee Vasudev erinnert daran, dass „die Anerkennung von Quellen ein Grundprinzip des Designs“ sei. Wer dies ignoriere, praktiziere kulturelle Missachtung gegenüber Regionen, deren Kunst man angeblich bewundert.
Obwohl Indien großes wirtschaftliches Potenzial bietet, sehen viele internationale Labels das Land eher als Produktionsstandort denn als bedeutenden Markt. Prognosen zeigen zwar ein starkes Wachstum im indischen Luxussegment, doch viele Marken investieren kaum. Laut dem Berater Arvind Singhal bleiben Besucherzahlen in Luxusmalls niedrig. Für viele Inder seien Namen wie Prada bedeutungslos – nur ein kleiner Kreis der Superreichen habe überhaupt Interesse.
Indien als Ideengeber, nicht nur als Werkbank
Der Modedesigner Anand Bhushan aus Delhi unterstreicht: Indien stellt seit Jahrzehnten hochwertige Handwerkskunst für internationale Marken her. Doch dieser Beitrag bleibe meist unsichtbar. „Nur weil indische Kunsthandwerker Produkte anfertigen, heißt das nicht, dass man kulturelle Symbole bedenkenlos übernehmen darf“, so Bhushan. Er nennt die Chanel-Kollektion „Paris-Bombay“ von 2011 als Beispiel: Sie zeigte indisch inspirierte Designs – doch viele kritisierten die Darstellung als klischeehaft und oberflächlich.
Trotz dieser Probleme erkennt die Modejournalistin Nonita Kalra bei Prada eine echte Einsicht. Die Reaktion auf den aktuellen Vorfall zeige Bereitschaft zur Korrektur. Ihrer Meinung nach liegt das größere Problem in der Zusammensetzung der Entscheidungsträger westlicher Marken. Ein Mangel an kultureller Vielfalt im Management führe dazu, dass nicht-westliche Konsumenten oft falsch verstanden oder schlicht übersehen würden.
Indien muss sein eigenes Erbe schützen
Die Debatte um kulturelle Aneignung bringt auch Indien selbst in die Verantwortung. Viele Kunsthandwerker arbeiten unter schwierigen Bedingungen – mit wenig Lohn und ohne rechtlichen Schutz für ihre Werke. Ihre Kreationen brauchen oft Wochen, sind aber international kaum abgesichert.
Shefalee Vasudev sieht hier ein strukturelles Problem: „Wir geben unseren Handwerkern selbst zu wenig Wertschätzung.“ Auch Laila Tyabji, Vorsitzende der Organisation Dastkar, kritisiert das Konsumverhalten. In Indien werde über handgemachte Schuhe gefeilscht, während importierte Markenschuhe mühelos gekauft würden – obwohl sie aus Maschinenfertigung stammen.
Solange diese Haltung besteht, werden internationale Designer weiterhin indisches Kulturgut nutzen – ohne Rücksicht auf Ursprung oder Bedeutung. Wirklicher Wandel beginne laut Tyabji erst, wenn Inder selbst beginnen, ihr kulturelles Erbe zu schützen, zu würdigen – und rechtlich zu verteidigen.