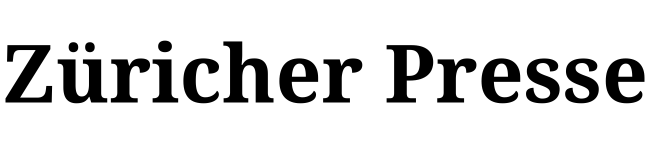Arbeitswelt im Umbruch – Staatseinnahmen in Gefahr
Künstliche Intelligenz bedroht zahlreiche Berufe und könnte das Steuersystem destabilisieren. Der Genfer Steuerexperte Xavier Oberson sucht nach Auswegen. In seiner eleganten Kanzlei unterstützt er Firmen und wohlhabende Mandanten beim Steuern sparen. Gleichzeitig unterrichtet er Steuerrecht an der Universität Genf.
In seinem neuesten Buch behandelt er die aufgeladene Frage, ob KI besteuert werden sollte – und wenn ja, wie. Die Reaktionen auf seine Thesen fielen heftig aus. „Neomarxistischer Spinner“ sei noch einer der höflicheren Kommentare, wie Oberson berichtet. Solche Angriffe habe er in der wissenschaftlichen Welt nie zuvor erlebt.
Einkommensverluste führen zu Steuerausfällen
Oberson argumentiert, dass die zunehmende Automatisierung verheerende Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen haben könnte. Wenn Maschinen Menschen ersetzen, sinken Einkommen, der Konsum bricht ein, und damit auch die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Sozialhilfe für Arbeitslose.
„Wenn die Löhne wegfallen, brechen die Beiträge zu Sozialwerken ein“, warnt Oberson. Für ihn steht fest: „Der Staat muss alternative Steuerquellen finden.“
Zusätzlich warnt er vor wachsender sozialer Ungleichheit. Nur wer Kapital besitzt, profitiert vom KI-getriebenen Gewinnwachstum. Wer hingegen auf ein Arbeitseinkommen angewiesen ist, trägt das Risiko, den Job zu verlieren.
Robotersteuer für Unternehmen statt Gerätebesteuerung
Wie aber könnte eine solche KI-Steuer konkret aussehen? Sollen bald Haushaltsroboter eine Steuerplakette tragen? Oberson verneint entschieden. Er schlägt stattdessen vor, Firmen zu besteuern, die durch KI Arbeitsplätze abbauen und dadurch Personalkosten sparen.
Wenn ein Unternehmen Stellen streicht und die Arbeit von KI übernehmen lässt, entfallen Löhne – und diese gesparten Ausgaben könnten als steuerpflichtiger Vorteil behandelt werden. Oberson vergleicht das Modell mit dem Eigenmietwert, den Hauseigentümer in der Schweiz versteuern müssen.
Eine Alternative wäre, die Technologie selbst zu besteuern. Auch heute zahlen Unternehmen Steuern auf ihre Gewinne, selbst wenn diese durch innovative Produkte entstehen – und das habe Innovation noch nie ausgebremst, argumentiert Oberson.
Damit ein solches Modell funktioniert, müssten jedoch alle wichtigen Wirtschaftsnationen mitziehen. Andernfalls würden Konzerne ihre KI-Entwicklung einfach in Länder ohne diese Steuer verlagern.
Prominente Unterstützung – Widerstand aus der Wirtschaft
Oberson steht mit seiner Forderung nicht allein. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates fordert seit Langem eine Robotersteuer. Dennoch stößt der Vorschlag in der Wirtschaft auf massiven Widerstand. Dort befürchtet man, dass eine neue Steuer die Innovationskraft drosseln könnte.
Für Oberson zählt dieses Argument nicht. „Auch Unternehmen, die durch geniale Erfindungen hohe Gewinne erzielen, zahlen Steuern – und trotzdem floriert der Fortschritt weiter“, entgegnet er.
Keine Eile – aber vorbereitet sein
Oberson und seine Gegner sind sich in einem Punkt einig: Derzeit braucht es keine neue Steuer auf KI. Noch sei unklar, ob die Technologie tatsächlich in dem befürchteten Ausmaß Arbeitsplätze vernichtet.
Sollte sich jedoch das pessimistische Szenario bewahrheiten, drohen gewaltige Folgen für Sozialsysteme und Staatsfinanzen. Für Oberson steht fest: Es sei klüger, rechtzeitig durchdachte Konzepte zu entwickeln, statt später unvorbereitet zu reagieren.