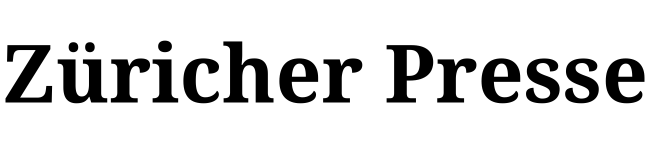Klimawandel bringt neue Risiken für die Stromproduktion
Ein massiver Felssturz bei Blatten zeigt die wachsenden Gefahren. Gletscher schmelzen, Berghänge werden instabil, und Starkregen nimmt zu. Betreiber alpiner Wasserkraftwerke kämpfen mit unberechenbaren Naturgewalten. Die Steuerung der Stauseen wird dadurch immer schwieriger.
Das Wallis produziert den meisten Strom aus alpiner Wasserkraft in der Schweiz. Bauwerke wie die Staumauer Grande Dixence speichern gewaltige Wassermengen. Das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance nutzt diese Höhenlage doppelt. Es erzeugt Strom und speichert Überschüsse durch Rückpumpen.
Der Stausee Ferden im Lötschental zählt zu den mittleren Anlagen. Die 67 Meter hohe Staumauer liegt in einem sensiblen Gebiet. Als sich bei Blatten die Situation zuspitzte, musste Enalpin sofort handeln. Martin Gattlen berichtet, man habe Wasser abgelassen, um Platz für eine mögliche Flutwelle zu schaffen. Gleichzeitig füllt der Fluss Lonza den See mit Geröll und Schlamm. Das beeinträchtigt die Stromgewinnung erheblich.
Sicherheit der Bauwerke wird weiterhin garantiert
Trotz der Herausforderungen sieht Gattlen keinen Grund zur Sorge. Die Staumauer ruht auf solidem Fels und gilt als stabil. Die Überwachung von Naturgefahren gehört zum Alltag der Betreiber – damals wie heute.
Auch bei Alpiq, das sechs grosse Speicherwerke im Wallis betreibt, bleibt man gelassen. Produktionsleiter André Murisier betont: Die Kontrollen laufen kontinuierlich. Nicht nur die Staumauern, sondern auch die umliegenden Berghänge werden regelmäßig überwacht. Beim Stausee Gibidum entdeckte man dank Sensoren frühzeitig eine Hangbewegung. Schutzmassnahmen wurden rasch umgesetzt. Inzwischen hat sich der Hang beruhigt.
Stauseen als Schutzschilde und Wasserreserven
Professor Robert Boes von der ETH Zürich sieht eine neue Rolle für Stauseen. Bei Starkregen oder Erdrutschen könnten sie gefährdete Täler schützen. Im Sommer hielt der Mattmark-Stausee riesige Wassermengen zurück. Das verhinderte im Saastal schlimme Überschwemmungen. In Zermatt – ohne vergleichbaren Speicher – kam es zu grossen Schäden.
Boes verweist auch auf den Nutzen für die Landwirtschaft. Schmelzende Gletscher reduzieren künftig den Wasserzufluss. Stauseen könnten als neue Reservoirs dienen. Das macht sie unentbehrlich – für Strom, Schutz und Bewässerung.
Die Betreiber stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. Sie müssen Energieproduktion, Sicherheit und Wasserbedarf gleichzeitig meistern. Die ganze Gesellschaft muss mitziehen, um diese Zukunft zu sichern.