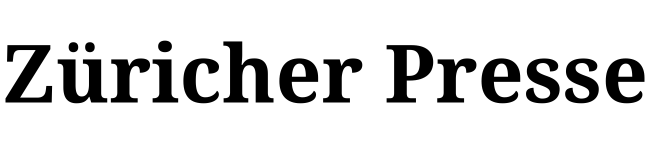Windkraft spielt künftig eine wichtige Rolle
Die Schweiz setzt auf eine Zukunft ohne fossile Energie. Windkraft soll dabei neben Solar- und Wasserkraft mithelfen. Doch derzeit liefert Wind weniger als ein Prozent des Schweizer Stroms. Der Bund plant bis 2030 einen Anteil von vier Prozent. Der Weg dahin ist steinig. Windanlagen stossen auf viel Widerstand.
Gegner warnen vor riesigen Windturbinen
In vielen Regionen wehren sich Anwohner, Gemeinden und Naturschützer gegen Windprojekte. Elias Vogt vom Verein für Naturschutz und Demokratie schlägt Alarm. Die geplanten Anlagen könnten bis zu 280 Meter hoch werden. „Das wären die grössten Windräder der Schweiz“, erklärt Vogt. „Solche Dimensionen sind für unser Land schwer vorstellbar.“ Deshalb lösten sie bei vielen Menschen starke Emotionen aus. Der Verein fordert mehr Mitspracherecht für die Bevölkerung. Zwei Volksinitiativen sollen das ermöglichen. Die erste verlangt, dass auch Nachbargemeinden über Windparks abstimmen dürfen. Die zweite will Rodungen im Wald für Windanlagen verbieten.
Finanzielle Beteiligung könnte helfen
An der Universität St. Gallen untersucht Professor Rolf Wüstenhagen Wege zur höheren Akzeptanz. Seine Forschung zeigt: Wenn die Bevölkerung finanziell beteiligt ist, steigt die Zustimmung. Er verweist auf das Beispiel der Wasserkraft. Dort sorgt der sogenannte Wasserzins für lokale Entschädigungen. Solche Modelle könnten auch bei der Windkraft helfen. Wüstenhagen testet deshalb eine neue Idee in der Ostschweiz. Er will herausfinden, ob Windaktien für Anwohner attraktiv sind. Diese könnten Miteigentümer von Windrädern werden. Sie trügen Risiken – hätten aber auch eine Gewinnchance. Ein nationales Energie-Forschungsprogramm unterstützt das Projekt.
Ein Blick über die Grenze
Noch stehen solche Modelle in der Schweiz ganz am Anfang. Doch Wüstenhagen schaut auch ins Ausland. In Deutschland zeigen erste Erfahrungen positive Effekte. „Man kann nicht pauschal sagen, dass es wirkt“, sagt er. „Aber es gibt viele Beispiele, wo es funktioniert hat.“ Ein entscheidender Punkt sei die Glaubwürdigkeit. In Norddeutschland überzeugten sich Menschen, dass ihnen kein anonymer Konzern ein Projekt aufdrängt. Sie fühlten sich durch ihre Beteiligung eingebunden. So konnten sie sich mit dem Projekt identifizieren.
Keine einfache Lösung – aber ein möglicher Weg
Wüstenhagen betont: Weder Windzins noch Windaktien lösen alle Probleme. „Es sind einzelne Elemente in einem grösseren Puzzle“, sagt er. Die Akzeptanz sei komplex. Man müsse an mehreren Stellen gleichzeitig ansetzen. Ein weiterer Aspekt sei die Gewöhnung. Steht bereits eine Windanlage, sinkt oft der Widerstand. Die Sorgen relativieren sich mit der Zeit. Das zeigt: Mit gezielten Massnahmen lässt sich Akzeptanz fördern. Und genau diese braucht es – für eine nachhaltige Energiewende in der Schweiz.