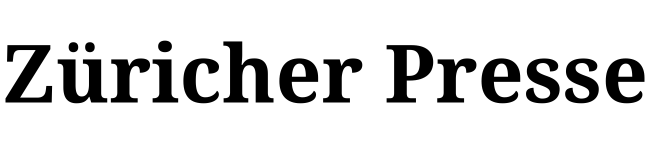Eine Untersuchung des Guardian hat ergeben, dass im Studienjahr 2023/24 fast 7.000 Studierende an britischen Universitäten beim unerlaubten Einsatz von KI-Tools wie ChatGPT ertappt wurden – ein starker Anstieg im Vergleich zum Vorjahr und laut Expert:innen nur ein Bruchteil der tatsächlichen Fälle.
Künstliche Intelligenz verdrängt traditionelle Plagiate
Während klassisches Copy-Paste-Plagiat rückläufig ist, nimmt der KI-Missbrauch rapide zu. Waren es 2022/23 noch 1,6 Fälle pro 1.000 Studierende, liegt die Quote aktuell bei 5,1 – mit einem prognostizierten Anstieg auf 7,5 pro 1.000 bis Jahresende. Gleichzeitig sank die Anzahl traditioneller Plagiate von 19 auf 15,2 pro 1.000 Studierende und soll bald unter 9 fallen.
Die Verfügbarkeit und Benutzerfreundlichkeit von generativer KI haben das Verhalten vieler Studierender verändert. Immer mehr nutzen die Tools zur Ideenfindung, Strukturierung oder gar zum Umgehen von KI-Detektoren durch sogenannte „Humanisierungs“-Tools.
Universitäten hinken bei Erfassung und Reaktion hinterher
Von 155 befragten Hochschulen konnten 131 überhaupt relevante Daten vorlegen. Über ein Viertel erfasste KI-Missbrauch noch nicht einmal als eigene Kategorie. Auch der Nachweis ist schwieriger: Während klassisches Plagiat durch Textvergleiche eindeutig belegt werden kann, ist KI-Nutzung schwerer zu beweisen, was viele Einrichtungen zögern lässt, disziplinarisch durchzugreifen.
Laut Dr. Peter Scarfe von der Universität Reading bleibt KI-Missbrauch oft unentdeckt – auch, weil viele Studierende mit intelligentem Einsatz die Erkennung umgehen. Tests zeigten, dass KI-generierte Arbeiten in 94 % der Fälle unbemerkt eingereicht werden konnten.
Differenzierte Nutzung – von Betrug bis Barriereabbau
Während einige Studierende KI gezielt zur Umgehung von Regeln verwenden, nutzen andere sie zur Unterstützung bei Legasthenie oder als Strukturierungshilfe. Besonders bei Menschen mit Lernschwierigkeiten sei der Einsatz sinnvoll, so eine befragte Studentin.
Doch die Entwicklung stellt das Bildungssystem vor ein Dilemma: Prüfungen vollständig in Präsenz durchzuführen ist kaum umsetzbar, gleichzeitig ist ein Verbot der KI-Nutzung realitätsfern. Immer mehr Stimmen fordern daher eine Überarbeitung der Prüfungsformen und stärkere Einbindung der Studierenden in die Gestaltung von Aufgaben.
Ausblick: Reformbedarf und Chancen durch KI
Laut Dr. Thomas Lancaster (Imperial College London) müssten Aufgaben künftig verstärkt auf nicht ersetzbare Kompetenzen wie Kommunikation, Teamfähigkeit oder Umgang mit neuer Technologie ausgerichtet sein. Die Regierung verweist auf Förderprogramme und Leitlinien für den KI-Einsatz im Bildungsbereich.
Generative KI biete laut Bildungsministerium enormes Potenzial für Bildungsgerechtigkeit – insbesondere zur Förderung benachteiligter Gruppen. Die Integration in Lehre und Prüfungssysteme müsse jedoch mit Bedacht erfolgen, um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren.